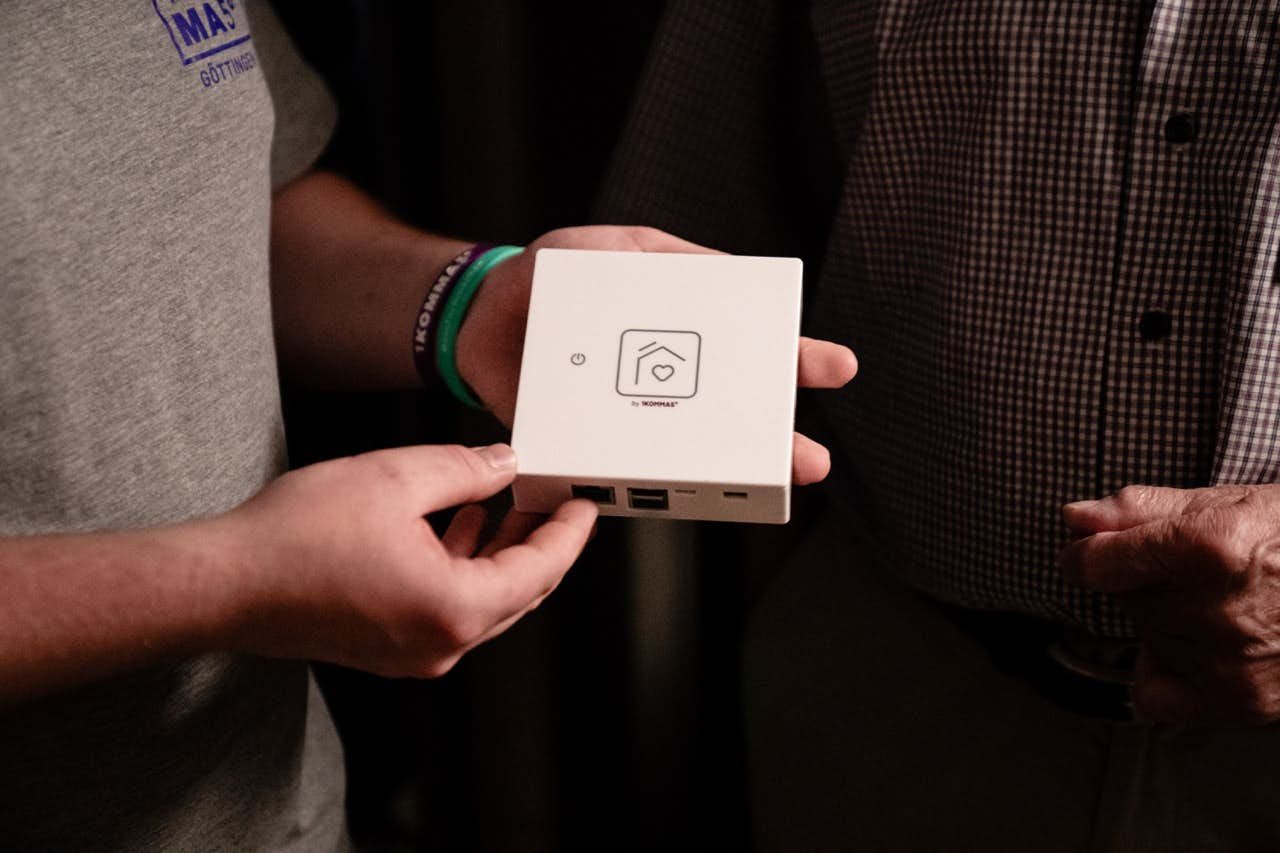Wärmepumpe vs. Wasserstoff – die Zukunft der klimaschonenden Wärmeerzeugung
Wieso Wasserstoff als Hoffnungsträger für die Energiewende gilt
Bei Wasserstoff handelt es sich um das am häufigsten vorkommende chemische Element auf der Erde. Nicht zuletzt deshalb wäre eine nachhaltige Nutzung des Elements als Energieträger sinnvoll.
Problem hierbei ist, dass Wasserstoff nicht einfach abgebaut, sondern energieintensiv durch Elektrolyse gewonnen wird. Hier wird Wasser mittels Anode und Kathode unter Strom gesetzt, wobei auf der Kathodenseite Wasserstoff gasförmig austritt und sich auf der Anodenseite Sauerstoff bildet.

Wasserstoff Gewinnung durch Elektrolyse, Quelle: IKV Aachen (2022)
Die Ergebnisse der Studie zur Wärmeerzeugung von Wasserstoff und Wärmepumpe im Detail
Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Norddeutsche Reallabor hat im Zuge ihrer Studienreihe "Grüner Wasserstoff für die Energiewende" den Einsatz von Wasserstoff zur dezentralen Wärmeerzeugung in Gebäuden erforscht und einen Vergleich zur modernen Wärmepumpe aufgestellt. Das Ergebnis ist aus Sicht des Autoren der Studie, Dr. Felix Doucet, “ernüchternd”.
Als Modell für die Studie diente ein unsaniertes Einfamilienhaus mit einem jährlichen Bedarf von 40.000 kWh Heizenergie. Das Umsetzungsbeispiel mit Wasserstoff zeigte, dass 67.000 kWh bei der Herstellung benötigt würden, um die erforderliche Energiemenge zu decken. Am Beispiel einer modernen Wärmepumpe mit einer angenommenen Jahresarbeitszahl von 3,4 ließ sich feststellen, dass nur 12.000 kWh für die Bereitstellung der Wärme benötigt werden. Erfahre in einem weiteren Artikel noch mehr über die Funktion der Wärmepumpe.
| Wärmeerzeugung mit… | Leistung um Energiemenge von 40.000 kWh zu decken |
|---|---|
| Wasserstoff | 67.000 kWh |
| Wärmepumpe | 12.000 kWh |
Ziel der Studie war es, eine effiziente und klimaschonende Alternative zur Wärmepumpe zu finden, jedoch zeigen die Studienergebnisse, dass sich der Einsatz von Wasserstoff im Wärmesektor nicht auszahlt. Im Vergleich zur Wärmepumpe ist für den Einsatz von grünem Wasserstoff fünf- bis sechsmal mehr Energie erforderlich, um denselben Wärmebedarf zu decken. "Aus Effizienzgründen ist der Einsatz von Wasserstoff für die dezentrale Wärmebereitstellung nicht zu priorisieren, da hier ein Vielfaches an grüner elektrischer Energie für die Elektrolyse im Vergleich zu einem Szenario mit Wärmepumpen notwendig wäre", so Felix Doucet.
Der Einfluss der Studie auf die Energiewende
Zusammenfassend zeigt die Studie, dass, wenn alle Gebäudenutzenden der festgestellten Vorteilhaftigkeit von Wärmepumpen folgen würden und es keine Restriktionen im Stromnetz gäbe, große Teile der bestehenden Gasnetzinfrastruktur in Wohngebieten obsolet werden könnten. Eine Ertüchtigung der Gasnetze für einen Wasserstofftransport in Wohngebiete wäre aus ökonomischer Sicht jedenfalls nicht zielführender als die ohnehin notwendige Modernisierung des Stromnetzes.
Wer sich tiefer in die Studienergebnisse einlesen möchte, kann dies über folgenden Link tun: https://norddeutsches-reallabor.de/presse/#studien
Weitere Artikel aus unserem 1KOMMA5° Magazin:
Hast du noch Fragen?
Solltest du noch Fragen haben oder dir ein persönliches Gespräch wünschen, melde dich gerne über unser Kontaktformular bei uns.
Wasserstoff ist das leichteste und einfachste chemische Element im Periodensystem. Es ist ein farbloses, geruchloses und hochentzündliches Gas. In seiner reinen Form besteht Wasserstoff aus einem einzelnen Proton und einem Elektron und ist daher das einfachste aller bekannten Elemente. Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum und kommt auf der Erde hauptsächlich in Verbindungen mit anderen Elementen vor, wie zum Beispiel im Wasser (H2O) oder in organischen Stoffen. Als Energieträger hat Wasserstoff ein großes Potenzial, da bei seiner Verbrennung oder Nutzung in Brennstoffzellen nur Wasser als Emission entsteht, wodurch er eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellt.
Wasserstoff kann in der Energiewende eine entscheidende Rolle zum Speichern von Energie spielen. Zum Heizen eignet er sich jedoch weniger, da das Heizen mit der Wärmepumpe gleichermaßen umweltfreundlich ist, während es einen Bruchteil an elektrischer Energie zur Wärmegewinnung verbraucht.
Grundsätzlich ist es möglich, mit Wasserstoff Häuser zu heizen. Das funktioniert zum Beispiel mit speziellen Brennstoffzellenheizungen. Zunächst ist das sogar eine umweltfreundliche Heizvariante, da beim Verbrennen von Wasserstoff keine Emissionen entstehen (außer Wasser). Allerdings ist für den Einsatz von Wasserstoff zum Heizen etwa fünf bis sechs Mal mehr Energie nötig als bei der Wärmepumpe. Das Verfahren ergibt also auch wirtschaftlich wenig Sinn.
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe ist im Allgemeinen geringer als der Verbrauch herkömmlicher Heizsysteme. Da Wärmepumpen Umweltwärme nutzen, benötigen sie nur einen geringen Anteil elektrischer Energie, um diese Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen.